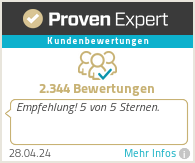Seit jeher beschäftigen sich Menschen mit dem Universum, dem Sternenhimmel und mit der Rolle, die die Erde im Kosmos einnimmt. Über Jahrhunderte wurden verschiedene Weltsysteme von Wissenschaftlern ent- und dann wieder verworfen: Von dem geozentrischen Weltbild der Antike, welches Claudius Ptolemäus mathematisch weiterentwickelte, über das von Nikolaus Kopernikus und Johannes Kepler geschaffene heliozentrische Weltbild. Auch in der Kunst wurden diese Weltbilder aufgegriffen und ästhetisch bearbeitet. Die wohl berühmteste Sammlung solcher Darstellungen ist die „Harmonia Macrocosmica“, ein reich bebilderter Himmelsatlas mit Kunstwerken von Andreas Cellarius.
Andreas Keller oder Andreas Cellarius, wie sein latinisierter Name lautet, war ein deutscher Astronom, Mathematiker und Kosmograph, der in der Barockzeit wirkte. Den Großteil seines Lebens verbrachte er in den Niederlanden, wo er vermutlich bereits ab den 1620er Jahren seine Arbeit an dem Himmelsatlas begann. Die Herstellung von Globen und präzisen Karten hatte in den Niederlanden schon eine lange Tradition und so war es auch ein flämischer Drucker, Johannes Janssonius, der im Jahr 1660 die „Harmonia Macrocosmica“ als Supplement zu seinem „Atlas Novus absolutissimus“ herausgab. Damit kam der, bereits vom berühmten Kartographen Gerhard Mercator geplante, Erd- und Himmelsatlas zu seinem Abschluss. In dem Atlas sind auf höchst aufwendig gestalteten und kolorierten Kupfertafeln die Entwicklung der Weltbilder und -systeme von Claudius Ptolemäus, Nikolaus Kopernikus und Tycho Brahe zu finden. Darüber hinaus sind in dem Atlas weitere acht Kupfertafeln mit Sternenkonstellationen nach christlicher und klassischer Interpretation abgebildet.
Im Jahr 1708 wurde der Atlas erneut veröffentlicht, diesmal von den Verlegern Gerard Valk und Petrus Schenk. Dort wurde auf die umfangreichen Textteile, die noch in der ersten Veröffentlichung zu finden waren, verzichtet. Diese Ausgabe ist heute im Besitz des Deutschen Museums in München. Heute gilt der Sternenatlas nicht nur als eines der spektakulärsten Kunstwerke in der Geschichte der Astronomie, er wird häufig auch als „Cellarius-Atlas“ bezeichnet. Und auch obwohl die Werke aus astronomischer Sicht überholt sind, zeugen sie dennoch von großem künstlerischem Handwerk und zeigen eine poetische Bildsprache. Einige der Stiche aus dem Buch werden sogar in Form großformatiger Metalltafeln zur Wandgestaltung in der U-Bahn-Station Kopernikusstraße in Hannover ausgestellt.
Über sein bekanntestes Werk hinaus, sind weitere Gravuren und Stiche von ihm überliefert, die sich zum einen mit Astronomie und der Arbeit von Wissenschaftlern auseinandersetzen, beispielsweise „Astronomen schauen durch ein Fernrohr“, als auch christliche Motive bearbeiten, zum Beispiel „Peter leugnen Christus“. Daneben veröffentlichte Cellarius 1645 die „Architectura Militaris“, ein Werk zum Festungsbau, sowie 1652 mit „Regni Poloniae“ eine Landeskunde Polens. Die thematische Vielfalt seiner Publikationen macht ihn zu einem typischen Gelehrten der Barockzeit.
In Gedenken an Andreas Cellarius wurde 2008 der Asteroid 12618 Cellarius nach ihm benannt.
×




 pub by Joannes Janssonius Amsterdam 1660-61 (hand coloured eng - (MeisterDrucke-160707).jpg)
 pub by Joannes Janssonius Amsterdam 1660-61 (hand coloured eng - (MeisterDrucke-160707).jpg)
 pub by Joannes Janssonius Amsterdam 1660-1 - (MeisterDrucke-114850).jpg)
 pub by Joannes Janssonius Amsterdam 1660-1 - (MeisterDrucke-114850).jpg)
 pub by Joannes Janssonius Amsterdam 1660-61 (hand coloured engraving) - (MeisterDrucke-87601).jpg)
 pub by Joannes Janssonius Amsterdam 1660-61 (hand coloured engraving) - (MeisterDrucke-87601).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 detail from a Map showing th - (MeisterDrucke-222916).jpg)
 detail from a Map showing th - (MeisterDrucke-222916).jpg)
 depicting the Ptolemaic and Tycho Brahe systems pub by Joannes Janss - (MeisterDrucke-76177).jpg)
 depicting the Ptolemaic and Tycho Brahe systems pub by Joannes Janss - (MeisterDrucke-76177).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 pub by Joannes Janssonius Amsterdam 1660 - (MeisterDrucke-86718).jpg)
 pub by Joannes Janssonius Amsterdam 1660 - (MeisterDrucke-86718).jpg)
 pub by Joannes Janssonius A - (MeisterDrucke-52996).jpg)
 pub by Joannes Janssonius A - (MeisterDrucke-52996).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 pub by Joannes Janssonius Amsterdam 1660-6 - (MeisterDrucke-215663).jpg)
 pub by Joannes Janssonius Amsterdam 1660-6 - (MeisterDrucke-215663).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 pub by Joannes Janssonius Amsterdam 1660-61 (hand coloured eng - (MeisterDrucke-90743).jpg)
 pub by Joannes Janssonius Amsterdam 1660-61 (hand coloured eng - (MeisterDrucke-90743).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_devised_by_Nicola_-_(MeisterDrucke-1351472).jpg)
_devised_by_Nicola_-_(MeisterDrucke-1351472).jpg)
.jpg)
.jpg)
_Atlas_Coelestis_seu_Harmonia_Macrocosmica_1661_Fol_-_(MeisterDrucke-1422948).jpg)
_Atlas_Coelestis_seu_Harmonia_Macrocosmica_1661_Fol_-_(MeisterDrucke-1422948).jpg)
.jpg)
.jpg)
 pub by Joannes Janssonius 1660-61 (hand coloured engraving) - (MeisterDrucke-145489).jpg)
 pub by Joannes Janssonius 1660-61 (hand coloured engraving) - (MeisterDrucke-145489).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 pub by Joannes Janssonius Amsterdam 1660-61 - (MeisterDrucke-193066).jpg)
 pub by Joannes Janssonius Amsterdam 1660-61 - (MeisterDrucke-193066).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 pub by Joannes Janssonius Amsterdam 1660-1 (engravi - (MeisterDrucke-197848).jpg)
 pub by Joannes Janssonius Amsterdam 1660-1 (engravi - (MeisterDrucke-197848).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 pub by Joannes Janssonius Amsterdam 1660-61 (hand - (MeisterDrucke-167122).jpg)
 pub by Joannes Janssonius Amsterdam 1660-61 (hand - (MeisterDrucke-167122).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_studying_globes_and_the_sky_chart_detai_-_(MeisterDrucke-1040888).jpg)
_studying_globes_and_the_sky_chart_detai_-_(MeisterDrucke-1040888).jpg)
_Hemisphere_from_The_Celestial_Atlas_or_the_Harmony_of_the_Univ_-_(MeisterDrucke-298641).jpg)
_Hemisphere_from_The_Celestial_Atlas_or_the_Harmony_of_the_Univ_-_(MeisterDrucke-298641).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 pub by Joannes Janssonius Amsterdam 166 - (MeisterDrucke-86816).jpg)
 pub by Joannes Janssonius Amsterdam 166 - (MeisterDrucke-86816).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 Hemisphere from The Celestial Atlas or the Harmony of the Universe engraved by Pieter Schenk (1660-1719) and Gerard Valk (1651-1726) (hand-coloured engraving) - (MeisterDrucke-81659).jpg)
 Hemisphere from The Celestial Atlas or the Harmony of the Universe engraved by Pieter Schenk (1660-1719) and Gerard Valk (1651-1726) (hand-coloured engraving) - (MeisterDrucke-81659).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 engraved by Pieter Schenk (1660-1719) and Gerard Valk - (MeisterDrucke-85722).jpg)
 engraved by Pieter Schenk (1660-1719) and Gerard Valk - (MeisterDrucke-85722).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 detail from a map showing his system of planetary orbits from The Celestial Atlas or The Harmony of the Universe (Atlas coelestis seu harmonia macrocosmica) pub by Joanne - (MeisterDrucke-71262).jpg)
 detail from a map showing his system of planetary orbits from The Celestial Atlas or The Harmony of the Universe (Atlas coelestis seu harmonia macrocosmica) pub by Joanne - (MeisterDrucke-71262).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 and Gerard Valk (1651-1726) (colour engraving) - (MeisterDrucke-55987).jpg)
 and Gerard Valk (1651-1726) (colour engraving) - (MeisterDrucke-55987).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)